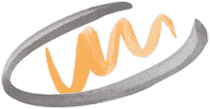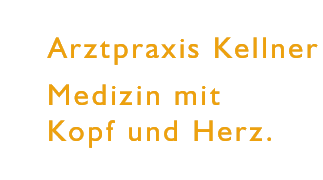Allgemeines
Leistungsspektrum
Diagnostik
Therapie
Über Dr. med. Alexandra Kellner
Über Anton Kellner
Kontakt
Ausstellung
Aktuelles:
• Melatonin-Infusion
• Longevity-Diagnostik
• Drip Spa Infusionstherapie
• Aktueller Podcastbeitrag
• Post-COVID-Syndrom
Texte zu den Spezialgebieten:
Bauchbeschwerden
Infos zur Mastzellaktivierungsstörung (MCAD)
Aktuelle Erkenntnisse zur Mastzellaktivierungsstörung (MCAD)
leaky gut
Die
Rolle der Diaminoxidase
Senkung
erhöhter Spiegel von Lipoprotein
Fallbericht
einer schweren Darmbarrierestörung
Studie
zu Insumood
Borreliose
Bitte
besuchen Sie unsere neue Homepage Borreliose-Saar
Verschiedenes
Multisystemerkrankungen (MSE)
Die Prostata als Müllhalde
Die Übersäuerung
Normalisierung
einer diastolischen Dysfunktion des Herzens durch Oxyvenierungstherapie
Neuroprotektion durch Carnosin
Polyphenole
und Tumorzellen
Vitalitätsreduktion
von Tumorstammzellen
|
Aktuelle Erkenntnisse zur Mastzellaktivierungsstörung (MCAS)
Stress und leaky gut:
Die Mastzellaktivierung kann eine Schädigung der Darmbarriere verursachen
("leaky gut"). Die Mastzellmediatoren können ferner
das Mikrobiom verändern. Zusammenhänge mit dem Lebensalter
sind anzunehmen: im Alter nimmt die Diversität der Darmbakterien
ab, die Häufigkeit von Mastzellaktivierung nimmt zu.
Darmbarriere und Blut-Hirn-Schranke (BHS) weisen einen ähnlichen
Aufbau auf.
Faktoren, die die Darmbarriere schädigen, können auch die
BHS beeinträchtigen (Mastzellmediatoren, Medikamente).
Das Steuerungshormon CRH, das die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
steuert, kann bei Stress eine Entzündung im Nervensystem verursachen.
Diese kann über die Microglia-Nervenzellen Mastzellen direkt aktivieren
und auf noch nicht geklärte Weise das Mikrobiom verändern.
Dies ist ein Bindeglied zwischen Stressbelastung und leaky gut.
Mastzellmediatoren können chronische psychosomatische Symptome
induzieren. Hinzu kommt eine Belastung des Hirnstoffwechsels durch Bakterientoxine
und Schadstoffe aus dem durchlässigen Darm. Es können komplexe
psychosomatische Störungsbilder erzeugt werden, die durch eine
alleinige Psychotherapie oder Psychopharmakagabe nicht kuriert werden
können.
Da Histamin Schmerzfasern stimuliert, ist auch eine effektive Schmerztherapie
wichtig, um das Stressniveau zu senken.
Einflussfaktoren:
Im gesunden Darm dämpft das gesamte Milieu die Mastzellaktivität
(Mikrobiom, auch ansässige Pilze und Viren). Aktivierend wirken
sinnvollerweise nur Antigene von Erregern, freie Sauerstoffradikale,
Gallensäuren, Neurotransmitter.
Bei MCAS wirken selbst Reize wie Druck, Hitze und Veränderungen
der Osmolarität pathologisch aktivierend.
Probiotika wirken Mastzell-stabilisierend und fördern die Apoptose
(den programmierten Zelltod) von Mastzellen. Welche Bakterienstämme
individuell am besten wirken, kann momentan nur durch Ausprobieren geklärt
werden.
Die Mastzellgranulation wird durch saures Milieu (pH-Wert kleiner 7)
aktiviert, das heißt die Bildung und Speicherung von Mediatoren
wie Histamin wird gesteigert. Dies führt bei Freisetzung der Mediatoren
(Degranulation) zu besonders heftigen Reaktionen.
Das saure Milieu spielt auch beim Urin eine Rolle. In der Blase und
der Prostata kann dadurch eine chronische mastzellbedingte Entzündung
gefördert werden (interstitielle Zystitis – "Blasenentzündung
ohne Bakterien", Hunner-Zystitis, chronische abakterielle Prostatitis).
Im Magen-Darm-Trakt werden eventuell säurehaltige Nahrungsmittel
oder Präparate schlecht vertragen (ASS, Vitamin C, eventuell sogar
Lactobacillus-haltige Probiotika). Dies wird durch eine vermehrte Bildung
von Cyclooxygenase 2 (COX 2) durch die Mastzellen verursacht.
Diagnostik
Bei der Labordiagnostik haben wir in letzter Zeit zusätzliche diagnostische
Erkenntnisse über eine vermehrte Produktion von Mastzellmediatoren
gewinnen können:
- durch die Bestimmung der Leukotriene im Urin und
- durch die Erfassung einer erhöhten endogenen Heparinproduktion
über die Messung der Anti Xa-Aktivität im Plasma
Eine neue Möglichkeit, das Vorliegen eines leaky gut im Bereich des
terminalen Ileums (letzter Abschnitt des Dünndarms, in dem eine besonders
hohe Dichte von Mastzellen vorliegt) nachzuweisen, ist die intravenöse
Gabe des Farbstoffs Fluoreszein während einer Darmspiegelung. Bei
leaky gut färbt der Farbstoff die durchlässige Schleimhaut blau.
Dies kann semiquantitativ bei der Spiegelung dokumentiert werden.
Therapie
Eine basenbildende, pflanzenreiche Ernährung ist hilfreich. Auch
eine unterstützende Gabe von Citraten (Magnesium, Kalium) ist eventuell
erforderlich. Reicht dies nicht aus, kann die vorübergehende Gabe
von Natriumbicarbonat erwogen werden.
Im Rahmen der Ernährungstherapie sind auch antientzündliche
Öle sinnvoll.
Bei besonders starker Symptomatik ist es eventuell vorübergehend
notwendig, Antihistaminika intravenös zu verabreichen, um die Wirkung
zu optimieren. Auch Infusionen mit Vitamin C sind hilfreich. Die Stabilisierung
der Darmschleimhautbarriere kann mit intravenöser Gabe von L-Alanyl-Glutamin
und Phospholipiden unterstützt werden.
Bezüglich der medikamentösen Therapie hat sich in letzter
Zeit auch im Bereich des MCAS eine bedenkliche Versorgungslücke
gezeigt. Über längere Zeit waren die bewährten H2-Rezeptorenblocker
wie Ranitidin oder Famotidin nicht verfügbar. Als einziges lieferbares
Medikament blieb Cimetidin übrig, welches aber offenbar als Nebenwirkung
die Aktivität der Diaminoxidase (DAO) blockiert und somit für
viele Betroffene keine Alternative darstellt.
Wegen der Vielfalt der Symptome der MCAS und der wechselnden Verlässlichkeit/Sensitivität
von Labortests ist das positive Ansprechen der Beschwerden auf eine Therapie
mit Antihistaminika und Mastzellstabilisatoren ein wichtige Kriterium
der Diagnosefindung.
Therapeutisch hat sich bei einzelnen PatientInnen der Einsatz von IgE-blockierenden
Antikörpern (z.B. Omalizumab) bewährt. Der Ansatz gelingt wahrscheinlich
am besten, wenn Autoantikörper gegen den IgE-Rezeptor vorliegen.
Diese sind eventuell mit dem Vorliegen von Schilddrüsenantikörpern
verbunden.
Der Leukotrienantagonist Montelukast ist länger schon erfolgreich
im Einsatz (wenn eine erhöhte Aussscheidung von Leukotrienen nachweisbar
ist.
Bei den Pflanzenstoffen erweist sich Quercetin als ein guter Mastzellstabilisator.
Low dose Naltrexon (LDN) wirkt entzündungshemmend und immunstabilisierend
und erhöht die Endorphinspiegel.
Melatonin hat neben der unterstützenden Wirkung auf den natürlichen
Schlaf einen starken antioxidativen Effekt.
nach
oben Δ
|
Arztpraxis Kellner
Talstraße 17
66119 Saarbrücken
| Telefon |
0681 - 5 34 91 |
| Fax |
0681 - 5 34 44 |
Neue Email:
praxis-dr-kellner@t-online.de
Sprechzeiten
Mo - Fr vormittags
von 8 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
 Nous parlons
français! Nous parlons
français!
 Bitte
lesen Sie die Bitte
lesen Sie die
Corona-Info!
AnfahrtLage- und Anfahrtsplan
|