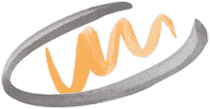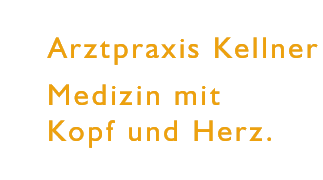Allgemeines
Leistungsspektrum
Diagnostik
Therapie
Über Dr. med. Alexandra Kellner
Über Anton Kellner
Kontakt
Ausstellung
Aktuelles:
• Melatonin-Infusion
• Longevity-Diagnostik
• Drip Spa Infusionstherapie
• Aktueller Podcastbeitrag
• Post-COVID-Syndrom
Texte zu den Spezialgebieten:
Bauchbeschwerden
Infos zur Mastzellaktivierungsstörung (MCAD)
Aktuelle
Erkenntnisse zur Mastzellaktivierungsstörung (MCAD)
leaky gut
Die
Rolle der Diaminoxidase
Senkung
erhöhter Spiegel von Lipoprotein
Fallbericht einer schweren Darmbarrierestörung
Studie
zu Insumood
Borreliose
Bitte
besuchen Sie unsere neue Homepage Borreliose-Saar
Verschiedenes
Multisystemerkrankungen (MSE)
Die Prostata als Müllhalde
Die
Übersäuerung
Normalisierung
einer diastolischen Dysfunktion des Herzens durch Oxyvenierungstherapie
Neuroprotektion
durch Carnosin
Polyphenole
und Tumorzellen
Vitalitätsreduktion
von Tumorstammzellen
|
Multisystemerkrankungen (MSE) - eine diagnostische und therapeutische
Herausforderung
Einführung
In unserer Praxis werden wir seit langem von PatientInnen konsultiert,
die an einer Vielzahl von Symptomen leiden. Diese können nicht
ohne weiteres unter Diagnosen von Erkrankungen eingeordnet werden, die
nach gängigen Leitlinien zu behandeln sind. Die Betroffenen haben
häufig eine Odyssee mit multiplen Arztbesuchen, verschiedensten
Diagnosen und letztendlich subjektiv unbefriedigenden Therapieversuchen
hinter sich.
Aus unserer Sicht ist es zielführend, den Horizont zu weiten, auf
verschiedenen Ebenen nach Ursachen zu suchen und je nach Gewichtung
zu behandeln. Dieses multifaktorielle Krankheitsmodell erfordert allerdings
auch von Seiten der PatientInnen Motivation, Eigeninitiative, Durchhaltevermögen
und Zuversicht. Wunderlösungen sind selten.
Bei den Multisystemerkrankungen sind, wie der Begriff schon impliziert,
mehrere Organsysteme betroffen.
Diese sind:
- Das Immunsystem
- Das Verdauungssystem
- Das Herz-Kreislauf- und Atmungssystem
- Das zentrale und periphere Nervensystem
- Das Hormon- und Stoffwechselsystem
- Das muskuloskelettale System (Stütz-,
Haltungs- und Bewegungssystem)
- Das urogenitale System
Hinzu kommen das blutbildende System sowie die Haut mit ihren Anhangsgebilden
Die Psyche rezipiert und modifiziert die Einflüsse aller oben genannten
Organsysteme und bewertet die Lebensqualität.
Ursachen
In den meisten Fällen sind mehrere oder viele Auslöser zu
finden.
Sind diese Auslöser noch aktiv, müssen sie ursächlich
mitbehandelt werden. Sind sie nicht mehr aktiv, muss man klären,
ob Residuen oder Strukturschäden übriggeblieben sind, die
mit dem Ziel der Regeneration ebenfalls therapiert werden müssen.
Ein Beispiel: die chronische Borreliose ist in vielen Fällen
eine Multisystemerkrankung. Regelhaft finden wir zusätzlich zu
der aktiven Infektion Erkrankungen wie leaky gut, Metallbelastung, Nährstoffdefizite,
Nahrungsunverträglichkeiten, Histaminprobleme. Eine alleinige Behandlung
mit Antibiotika ohne Berücksichtigung dieser Komorbiditäten
ist nach unserer Erfahrung und Überzeugung kontraproduktiv.
Im Laufe des Lebens kumulieren die Auslöser. Anfänglich werden
einzelne Belastungen noch überwunden oder kompensiert. Je mehr
zusammenkommt, beziehungsweise je mehr die Kompensationsmechanismen
überfordert werden, umso mehr nimmt die Symptombelastung zu. Irgendwann
läuft der Topf über und der Zusammenbruch (z.B. Burnout, systemische
Erkrankung) ist da. Dann gibt es keine einfachen und schnellen Lösungen
mehr.
Gemeinsam ist den Störungen der genannten Systeme eine chronische
mitochondriale Dysfunktion, die Auslöser, Folgeerscheinung
oder Trigger des um sich greifenden Krankheitsgeschehens ist.
Störungen der mitochondrialen Funktion äußern sich in
Problemen der Energiegewinnung, der Regulation der Organfunktionen,
der Differenzierung, der Fortpflanzung, der Entgiftung und des programmierten
Zelltodes (Apoptose und Autophagie).
Ein weiteres gemeinsames Element bei den MSE ist eine regelmäßig
nachweisbare systemische Entzündung (Inflammation) und eine
Beeinträchtigung der Regulation des Immunsystems.
Die Symptome der MSE sind vielgestaltig. Sie werden unter anderem
mit den Begriffen chronisches Fatiguesyndrom (CFS), myalgische Enzephalomyelitis
(ME) und Fibromyalgiesyndrom belegt.
Da sich die Störungen meist über einen längeren Zeitraum
kumulativ aufbauen, ist eine detaillierte Anamnese wichtig. Hier
müssen die PatientInnen durch eine genaue Beschreibung von Lebensereignissen,
Erkrankungen, Therapien usw. in Bezug auf den Beginn von Symptomen ihren
Beitrag leisten. Die objektive Wertung ist dann Aufgabe der Spezialistin/des
Spezialisten.
Eine Erkenntnis unserer langjährigen Beschäftigung mit diesen
Krankheitsbildern ist, dass die Erkrankungen unbehandelt zum Fortschreiten
und weiterer Chronifizierung führen.
Im Folgenden beschreiben wir Einflüsse auf die verschiedenen Organsysteme,
die zu Störungen führen können:
1. Immunsystem
Allgemeines
Das Immunsystem ist im Organismus angelegt, um in Erwartung von Verletzungen
oder Attacken körperfremder Stoffe oder Organismen, korrespondierende
Programme für Schutz, Abwehr und Reparatur in Gang zu setzen (Maitland,
2018).
Es kann es zu einer Schwäche oder einer Fehlregulation mit den Folgen
Autoimmunität/Allergie bzw. Toleranzverlust/Überreaktion (z.
B. Zytokinsturm) kommen.
Eine Schwächung des Immunsystems kann auch dazu führen, dass
"Bewohner" unseres Organismus wie Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten
nicht mehr in Schach gehalten und kontrolliert werden, sondern symptomatisch
werden. Dies zeigt sich am Beispiel des Herpes simplex -Virus. Die meisten
Menschen tragen den Virus in sich. Bei manchen kommt es alle paar Wochen
zu einem Ausbruch, bei anderen alle 5 Jahre. Auch die Tatsache, dass sich
Borrelien dauerhaft im Organismus aufhalten, muss nicht zwangsläufig
ein Problem sein, wenn das Immunsystem die Erreger effektiv unterdrücken
oder bekämpfen kann.
Symptome von Immunstörungen sind Infektanfälligkeit, Müdigkeit,
Zeichen von Entzündung, kognitive Beeinträchtigung (sog. Brain
Fog), sowie der breite Symptomkomplex der Autoimmunerkrankungen je nach
Organbeteiligung.
Da das Immunsystem zu 70% im Darm lokalisiert ist, muss dieser vorrangig
untersucht werden. Auch das Mastzellsystem, das vorrangig an den Eintrittspforten
für Umweltstoffe auf den Schleimhäuten aktiv ist, spielt eine
große Rolle (lesen Sie hierzu bitte die Artikel über Mastzellaktivierung).
Einfluss Faktoren
- Angeborene Defekte der humoralen oder zellulären Abwehr
- Leaky gut
- Dysbiose /Störungen des Mikrobioms
- Akute Infektionen
- Chronische Infektionen (Persistenz von Erregern wie Borrelien,
Epstein-Barr-Virus, Zoster-Virus, Herpesvirus, Chlamydien, Helicobacter
pylori etc. wird durch Immunschwäche oder durch spezielle Persistenz-
oder Stealth - Mechanismen gefördert (L-Formen und Biofilm bei
Borreliose, Neutralisierung von Magensäure durch Helicobacter).
Auch Konfrontation mit ungewohnten/schwerer erkennbaren Erregern (Klimawandel,
Tourismus) oder neuen/mutierten Viren (COVID 19) kann das Immunsystem
überfordern.
- Chronische Entzündungsherde (Zähne, Prostata)
- Oxidativer und nitrosativer Zellstress
- Toxische Umwelteinflüsse (Metalle, Pestizide, Weichmacher,
Strahlung, Rauchen, Alkohol, Drogen)
- Individuell toxische oder unverträgliche Medikamente
- Genetisch bedingte Störungen der Entgiftung (Phase 1 und 2)
- Nährstoffdefizite
- Individuell unverträgliche oder toxische Ernährung
- Untergewicht (Leptinmangel)
- Adipositas (silente Inflammation)
- Psychosozialer Stress (Trauma, Depression, Isolation, Schlafmangel,
Schlafapnoe)
- Bewegungsmangel /Sauerstoffmangel
Die genannten Störungs- und Schädigungsfaktoren sind
auch bei den im Folgenden beschriebenen Organsystemen in gleicher Weise
von Bedeutung.
2. Das Verdauungssystem
Allgemeines
Symptome sind Schmerzen, Krämpfe, Verstopfung, Durchfall, Entzündungsbeschwerden,
Zeichen der Toxinbelastung in Regionen außerhalb des Verdauungstraktes
(z.B. Gelenke, Kreislauf, Nervensystem), Gewichtszunahme u.v.m. (Für
detaillierte Informationen lesen Sie bitte den Artikel zu Leaky gut).
Störungen sind hier bei den einzelnen Stationen des Verdauungsvorganges
möglich. Betroffen sein können:
- Die Vorverdauung (abhängig vom Zahnstatus, Kauvorgang, Speichelproduktion)
- Die Verdauung (abhängig von Produktion von Verdauungssäften
des Magens (Magensäure, Pepsin), Pankreasenzymen, Gallensäuren,
enteralen Hormonen)
- Beweglichkeit / Peristaltik (Magen, Darm)
- Transport und Resorption von Nahrungsbestandteilen
- Umwandlung und Bildung von Vorstufen / Metaboliten/ Botenstoffen
durch das Mikrobiom
- Bildung und Aufnahme unerwünschter Stoffe (Histamin, Toxine,
Metalle, Lipopolysaccharide (LPS))
- Entgiftung (durch unregelmäßige und unvollständige
Stuhlentleerung)
- Rolle der Leber als Entgiftungs- und Entzündungsorgan
- Darm-Hirn-Achse
- Auslösung von unerwünschten Reaktionen auf Nahrungsbestandteile
- Informationsvermittlung an andere Organsysteme (Exosomen)
Beim Verdauungssystem finden sich fast regelhaft 2 zentrale Störungen:
Eine Schädigung der Darmschleimhautbarriere, die zum Bild des durchlässigen
Darms ("leaky gut") führt (das Spektrum reicht hier
vom "Reizdarm" bis zur chronisch-entzündlichen Darmerkrankung)
Eine krankhafte Störung des Mikrobioms (Dysbiose)
Eine große Bedeutung hat auch die bakterielle Überwucherung
des Dünndarms (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO)
Besonders häufige Auslöser für diese Störungen sind
Antibiotika, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, psychosozialer
Stress und Schadstoffe.
3. Herz-Kreislauf- und Atmungssystem
Allgemeines
Die Versorgung aller Zellen über das Blut mit Nährstoffen
und Sauerstoff ist Voraussetzung für die mitochondriale Funktion.
Sie wird von Herz, Lunge und Blutgefäßen bewerkstelligt.
Arteriosklerose ist eine Degeneration der Gefäßwände
mit der Folge einer Gefäßverengung und verschlechterten Durchblutung.
Folgen der Arteriosklerose sind immer noch die häufigste Todesursache
der westlichen Welt. Die etablierten Hauptursachen für arterielle
Gefäßschädigung sind Bluthochdruck, Insulinresistenz
/ Diabetes mellitus, freie Radikale aus dem Fettstoffwechsel (oxidiertes
LDL-Cholesterin, Lipoprotein (a)), chronische Entzündung, krankhafte
Aktivierung der Blutgerinnung, erhöhte Harnsäure und Schwermetalle
wie Blei. Diese Aufzählung der Ursachen zeigt wiederum den Zusammenhang
zwischen Arteriosklerose und Störungen anderer Organsysteme.
Arteriosklerose betrifft einerseits die großen Gefäße
(Makroangiopathie). Sie kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall, peripherer
arterieller Verschlusserkrankung (pAVK), Aortenaneurysma, und Nierenarterienstenose
führen.
Von großer Bedeutung ist auch die Störung der Mikrodurchblutung.
Mikroangiopathie ist auch über die oben genannten Risikofaktoren
erklärbar. Zusätzlich spielen lokale Faktoren wie Kompression,
Entzündung mit Mikrothrombose und toxische Schädigung eine
Rolle. Sie betrifft in besonderem Maße die Augen, Nieren, Nerven,
das Gehirn und Herz. Mikroangiopathie kann man diagnostisch gut am Augenhintergrund
(Netzhaut) erkennen.
Störungen der Lungenfunktion sind durch eine Vielzahl von Auslösern
möglich. Zu den beeinflussbaren Faktoren zählen Rauchen, Feinstaubbelastung,
Allergie/Histamin/ Mastzellaktivierung und Bewegungsmangel.
4. Das zentrale und periphere Nervensystem
Allgemeines
Aufgaben sind Steuerung-Koordination-Regulation-Sensorik-Kommunikation-Homöostase-Kontakt
zur Umwelt.
Kommt es zu Störungen oder Schädigung von Strukturen oder
Funktionen, kann sich dies auf alle übrigen Organsysteme auswirken
Von der Vielzahl neurologischer Erkrankungen sollten nach unserer Erfahrung
die Folgenden über den MSE-Ansatz untersucht und behandelt werden:
- Neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz und Parkinson (hier besteht
allerdings das Problem der Früherkennung, das heißt, die
Defekte sind zum Zeitpunkt der Diagnose häufig weit fortgeschritten
und nicht mehr rückbildungsfähig)
- Periphere und autonome Neuropathie (mögliche, eventuell unerkannte
Ursachen sind Toxinbelastung, Entzündung durch Lipopolysaccharide
(LPS), Störungen der Mikrozirkulation, Infektionen wie seronegative
Borreliose, Bartonellose)
- Multiple Sklerose (zum Schutz des Nervensystems ist hier eine medikamentöse
Therapie häufig unverzichtbar)
Praktisch relevant sind auch Störungen der Regulation des
vegetativen (autonomen) Nervensystems. Sie führen zu einer
verschlechterten Anpassung der Organfunktionen an wechselnde Anforderungen.
Dies wirkt sich besonders im Verdauungstrakt und Herz-Kreislaufsystem
aus. Erfassen kann man die Störung über die Messung der Herzfrequenzvariation
(HRV).
Eine autonome Dysregulation ("Starre") erhöht das Risiko
für Herzinfarkt und Schlaganfall, da sie zu einer Mehrbelastung
von Herz und Gefäßen führt.
Eher zu wenig Beachtung finden Störungen der Kreislaufregulation
wie das posturale orthostatische Tachycardiesyndrom (POTS), das
im Stehen zu beschleunigtem Herzschlag ohne Blutdruckabfall führt
oder die hypoadrenerge orthostatische Dysregulation mit Blutdruckabfall.
Zu diesem Komplex gehört auch die neurokardiogene Synkope
mit verlangsamtem Herzschlag und Kollapsneigung.
Die Diagnosestellung mit dem Kipptisch ist exakter möglich als
mit dem einfach durchzuführenden Schellong-Test oder 10-Minuten-Stehtest.
Die POTS kann mit einer Regulationsstörung der Volumenverteilung
von Körperflüssigkeiten und mit einer Dekonditionierung verbunden
sein kann. Eine Abgrenzung zur Mastzellaktivierung ist erforderlich.
5. Hormonelles System/Stoffwechselsystem
Allgemeines
Hormonelle Störungen können eine Vielzahl von Symptomen und
Beschwerden auslösen, die die Lebensqualität massiv beeinträchtigen
können.
Hormonelle Defizite können durch Alterung entstehen (Menopause
der Frau und des Mannes). Sie führen zur Rückbildung von Strukturen
(Involution), die je nach zeitlichem Verlauf nicht wieder rückgängig
gemacht werden können.
Für eine Reihe hormoneller Störungen ist die (viszerale –
Vermehrung von Eingeweidefett) Adipositas ein wesentlicher Auslöser.
Autoimmunstörungen können sich an mehreren drüsigen
Organen manifestieren. So kann eine chronische Schilddrüsenentzündung
vom Typ Hashimoto mit einer Autoimmunstörung der Nebenniere oder
einer Zöliakie vergesellschaftet sein. Eine unserer Patientinnen,
eine junge Frau, hat eine Hashimoto -Thyreoiditis, eine chronische Autoimmungastritis,
einen leaky gut mit Mikroentzündung der Darmschleimhaut und eine
schwere Mastzellaktivierung.
Die alleinige Messung des TSH-Wertes reicht in vielen Fällen nicht
aus, um ausreichende Informationen über die Gewebespiegel der Schilddrüsenhormone
zu erhalten. Begleitende Autoimmunphänomene bei Schilddrüsenentzündungen
wie zum Beispiel eine Entzündung des Muskelgewebes können über
gängige Labordiagnostik eventuell nicht nachgewiesen werden. Das
Zusammenwirken von Autoimmunentzündung der Schilddrüse, chronischer
(Virus-) Infektion und (Schwer-) Metallbelastung muss untersucht und behandelt
werden.
Wie sich Regulationsstörungen bei wichtigen Hormonen auswirken können,
zeigt das Beispiel des Insulins:
Es ist das wichtigste Hormon für Umwandlung und Weiterverarbeitung
der 3 essenziellen Brennstoffe Zucker, Eiweiß und Fett, die wir
mit der Nahrung zu uns nehmen. Es ist ein anaboles (aufbauendes) Hormon,
hat Wirkungen im Gehirn (Steigerung der kognitiven Leistung, zentraler
Sättigungsfaktor), blockiert den Fettabbau aus den Fettzellen und
fördert die Fettspeicherung (damit Fett in den Fettzellen und nicht
in den Organen abgelagert wird) und hat Auswirkungen auf den Tonus der
Gefäße. Beim Insulinresistenzsyndrom kommt es durch reduzierte
Signalwirkung an den Zielorganen und zunächst übersteigerte,
später abgeschwächte Produktion von Insulin, zu einer Fülle
von schädlichen Wirkungen (metabolisches Syndrom, chronische Entzündung,
Förderung der Tumorentstehung, weitere Zunahme der Adipositas, Serotoninmangel,
Appetitenthemmung, Schlafapnoe usw.)
Cortisol ist das wichtigste Aktivitäts- und Stresshormon.
Es wird in der Nebenniere gebildet. Eine akute Freisetzung des Hormons
macht wach und aufmerksam, ermöglicht Kampf oder Flucht und stellt
die dafür notwendige Energie in Form von Brennstoffen bereit. Eine
chronische (Über-) Beanspruchung kann zur Erschöpfung der Cortisolproduktion
führen und stattdessen zu Aktivierung von Stresshormonen wie Adrenalin
und Noradrenalin mit der Folge von Bluthochdruck und Belastung von Herz
und Gefäßen.
6. Das muskuloskelettale System
Allgemeines
Die Muskelmasse ist das größte Stoffwechselorgan im menschlichen
Organismus.
Bewegungsmangel führt zu verringertem Energieumsatz und verringerter
Sauerstoffaufnahme. Wichtige Impulse für die Immunfunktion sind reduziert.
Aktivierende Signale zum Gehirn fehlen. Mikro- und Makrodurchblutung nehmen
ab. Die mitochondriale Funktion nimmt ab. Die Stresstoleranz und Funktion
des vegetativen Nervensystems verschlechtern sich.
Die Bewegungsfähigkeit ist allerdings bei MSE häufig eingeschränkt.
Erkrankungen können neben mechanischer Abnutzung auch durch Entzündung
zur Schädigung von Strukturen führen. Trauma (Sturz) und Immobilität
führen zur teilweise irreversiblen Funktionseinschränkung von
Knochen, Gelenken, Bändern und Sehnen. Übersäuerung im
Zwischengewebe (Interstitium) durch Störung der Mikrozirkulation,
der mitochondrialen Energieproduktion und Entgiftung mit Toxinansammlung
wirkt störungsverstärkend.
2 besondere Störungsbilder sind bei MSE aus unserer Sicht zu beachten:
Die Instabilität des craniocervicalen Übergangsgelenks (Genickgelenk)
Sie ist häufig durch wiederholte Traumata (Schleudertrauma, Stürze,
Prellungen), eventuell in Kombination mit vorbestehenden anatomischen
Abweichungen bedingt. Sie führt durch Lockerung des haltenden Bandapparates
über wiederkehrende Nerveneinklemmungen und -Reizungen zu erhöhtem
Anfall von sogenanntem Nitrostress, der auf weitere Kopfnerven
und den gesamten Organismus übergreifen kann.
Er führt zu einer weiteren mitochondrialen Funktionsverschlechterung.
Zur Diagnose ist am besten eine Funktionskernspintomographie in einem
offenen System geeignet.
Zur Vertiefung dieses Themas kann ich die hochinteressanten Forschungsergebnisse
von Dr. Kuklinski aus Rostock empfehlen.
Ein weiteres Thema sind Hypermobilitätssyndrome. Das bekannteste
ist das Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS). Hier kommt es durch eine angeborene
Bindegewebsschwäche zu einer Überdehnbarkeit von Gelenken. Auch
die Blutgefäße und die Haut sind leichter verletzbar. Da bei
dieser Veranlagung häufig sportliche Betätigungen gewählt
werden, die diese Überbeweglichkeit nutzen (Kunstturnen, Ballett,
Eislauf), kann es zu einer Häufung kleinerer und größerer
Traumata über die Lebenszeit kommen, die wiederum zu erhöhter
Nitrostressbelastung und Entzündung führen. EDS ist eine seltene
Erkrankung (1 von 5000 Geburten). Sie kann mit dem sogenannten Beighton-Score
diagnostiziert werden. Bei EDS ist auch das Risiko für eine orthostatische
Intoleranz erhöht.
Geringer ausgeprägte Formen der Hypermobilität, die nicht die
Kriterien des EDS erfüllen ("hyper mobility spectrum disorders")
müssen unserer Meinung nach ebenfalls beachtet werden. Sie erhöhen
auch das Risiko der Instabilität des Genickgelenks.
Das gehäufte Auftreten von Mastzellaktivierung bei EDS kann unserer
Meinung nach dadurch begründet sein, dass Mastzellen auch im Bindegewebe
lokalisiert sind. Bei gehäuften Traumata und dadurch verursachten
Störungen der Homöostase im Bindegewebe kann es zu einer lokalen
und später systemisch um sich greifenden Aktivierung der Mastozyten
kommen.
7. Das urogenitale System
Ist zuständig für Fortpflanzung, Hormonproduktion, Entgiftung
und Regulation des Wasser-, Säure-Basen- und Elektrolythaushaltes.
Störungen der Fortpflanzungsfähigkeit können auf
eine traumatische oder infektionsbedingte Schädigung von Strukturen
wie Hoden, Eileiter oder Gebärmutterhals zurückzuführen
sein. Sie können durch Umweltschadstoffe bedingt sein (z.B. hormonaktive
Stoffe wie Bisphenol A, sogenannte endokrine Disruptoren, Schwermetalle,
Pestizide usw.). Adipositas kann ebenfalls durch hormonelle Störungen
oder eine chronische Inflammation zu reduzierter Fruchtbarkeit beitragen.
Auch mechanische Faktoren wie erhöhter Druck auf innere Organe und
Beckenboden durch die Fettmasse spielen eine Rolle.
Chronische Infektionen können das Tumorrisiko erhöhen
(HPV) oder erhebliche Beschwerden verursachen (Herpes simplex Virus 1
und 2).
Die Unterbauchorgane können bei Störungen des Mikrobioms und
reduzierter Immunfunktion der Schleimhäute zu Pilzinfektionen neigen.
Gehäufte Harnwegsinfektionen sind mit leaky gut und Dysbiose assoziiert.
Eine chronische Prostatitis ist ein eventuell über lange Zeit unerkannter
Entzündungsherd und erhöht das Tumorrisiko. Chronische Entzündungen
der ableitenden Harnwege können zu einer Schädigung der Nieren
und in der Folge zu einer Störung der Entgiftung führen. Auf
dieser Basis können Folgeerkrankungen wie renaler Bluthochdruck und
Störungen des Vitamin D-, Calcium- und Knochenstoffwechsels führen.
Harnsteinbildung kann durch Stoffwechselstörungen wie Gicht
verursacht werden. Adipositas und inadäquate Ernährung potenzieren
das genetisch bedingte Risiko. Das Mikrobiom beeinflusst den Abbau der
Oxalsäure, eines weiteren Faktors der Harnsteinbildung.
Die Haut
Ist unsere äußere Hülle und an der Regulation des Wärmehaushaltes
und der Homöostase beteiligt. Auch Lichtschutz und Vitamin D-Bildung
werden von der Haut geregelt.
Sie ist neben Leber/ Gallenblase, Darm und Niere durch die Schweißdrüsen
an der Entgiftung beteiligt.
An der Haut manifestieren sich viele Symptome, die mit Störungen
anderer Organsysteme wie Darm oder Immunsystem zusammenhängen
Diagnostik
Aus unserer Sicht ist eine umfassende labordiagnostische Abklärung
wichtig.
Sie sollte folgende Bereiche abdecken:
- Marker der Mitochondrien-Funktion
- Chronische Infektionen (Bakterien, speziell Borrelien, Viren, Parasiten,
nach Möglichkeit mit LTT)
- Immunfunktion
- Entzündungsmarker
- Organwerte
- Leaky gut
- Test auf SIBO (bakterielle Überwucherung des Dünndarms),
ggf. Differenzierung des Darm-Mikrobioms
- Histaminintoleranz/Mastzellaktivierung
- Nahrungsunverträglichkeiten (einschließlich Laktose-,
Fruchtzuckerunverträglichkeit)
- Autoimmunität (Autoantikörper)
- Wichtigste Nährstoffe
- Hormonstatus
- Überprüfung der HPA (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren)
– Achse (Cortisol-Tagesprofil)
- Oxidativer und nitrosativer Stress
- Toxische Metalle, ggf. weitere toxische Umweltstoffe (endokrine
Disruptoren, Pestizide usw.)
- Ggf. Gentests
Die Labordiagnostik ist in vielen Fällen eine Momentaufnahme.
Bei Mastzellaktivierung können zum Beispiel verschiedene Tests
nur kurzfristig pathologisch ausfallen, bei Borreliose gibt es inaktive
Phasen, in denen der LTT negativ ist, obwohl eine Infektion vorliegt
usw. Dennoch ist eine umfassende Labordiagnostik eine wichtige Hilfe,
um zum Beispiel die Entscheidung für potentiell nebenwirkungsträchtige
Behandlungen zu unterstützen. In jedem Fall sind Anamnese und klinisches
Bild zentrale Standbeine der Diagnosefindung.
Weitere Diagnostik muss je nach Bedarf erfolgen (HRV, Gefäßstatus,
zahnärztliche Abklärung, Sonographie, Gynäkologie, Neurologie,
Kardiologie, Angiologie, Orthopädie, Endokrinologie, Rheumatologie,
Hämostaseologie, Hämatologie, Radiologie, Urologie, Pulmologie,
HNO-Heilkunde, Psychologie, usw.).
Auch eine baubiologische Wohnraumuntersuchung muss erwogen werden.
Therapie
Sie baut auf den Ergebnissen der Ursachensuche auf und wird individuell
in Form eines Behandlungsplans erstellt.
Elemente sind:
- Verbesserung der mitochondrialen Funktion
- Zufuhr von Nährstoffen auf der Basis des labormedizinisch
nachgewiesenen Bedarfs
- "Darmaufbau"
- Optimierung der Ernährung (schadstofffrei, vitalstoffreich,
individuell verträglich, entzündungshemmend, das Körperfett
normalisierend)
- Entzündungshemmung, Mastzellstabilisierung
- Herdsanierung
- Abbau von schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung der Entgiftung, Schwermetallausleitung
- Bekämpfung aktiver Infektionen, nach Möglichkeit ohne
Darm und Immunsystem weiter zu schädigen
- Reduktion von oxidativem und nitrosativem Stress
- Stressabbau, Schlafförderung
- Förderung individuell angepassten Bewegungsverhaltens
- Körperorientierte Verfahren (Osteopathie, Physiotherapie,
Ergotherapie)
- Psychoedukation / psychosomatische Grundversorgung / Psychotherapie
Zusammenfassend bieten die oben skizzierten Erkenntnisse und
Maßnahmen die Möglichkeit, auch schwere chronifizierte Krankheitsverläufe
zu bessern oder sogar zu heilen.
Die Störungen können die einzelnen Organsysteme in unterschiedlicher
Ausprägung und Gewichtung betreffen. Entsprechend vielfältig
kann die Symptomatik aussehen.
Wichtig ist die ganzheitliche Sicht.
Aufbauend auf der möglicherweise in der Vergangenheit durchgeführten
Diagnostik und Therapie ist aus unserer Sicht eine möglichst zeitnahe
Abklärung der Lücken im Gesamtbild erforderlich, um zu einer
Gewichtung und Therapieempfehlung zu kommen.
Wenn nach sorgfältiger und umfassender Abklärung eine darauf
aufbauende Therapie nicht zur Verbesserung des Gesundheitszustandes
führt, ist die große Herausforderung herauszufinden, was
man übersehen hat.
Voraussetzungen für einen Therapieerfolg sind eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit von PatientIn und TherapeutIn und Geduld.
Abschließend betonen wir auch bei diesem Text, dass eine wissenschaftliche
Vollständigkeit oder Übereinstimmung mit den Kriterien der
sogenannten Evidenz-basierten Medizin nicht gegeben ist.
Es handelt sich um eine Meinungsäußerung auf der Basis langjähriger
Erfahrungen in der praktischen Medizin.
nach
oben Δ
|
Arztpraxis Kellner
Talstraße 17
66119 Saarbrücken
| Telefon |
0681 - 5 34 91 |
| Fax |
0681 - 5 34 44 |
Neue Email:
praxis-dr-kellner@t-online.de
Sprechzeiten
Mo - Fr vormittags
von 8 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
 Nous parlons
français! Nous parlons
français!
 Bitte
lesen Sie die Bitte
lesen Sie die
Corona-Info!
AnfahrtLage- und Anfahrtsplan
|